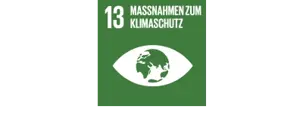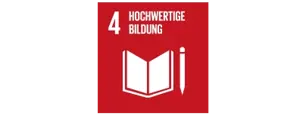VERBUND erzeugt vorwiegend Strom aus Wasser-, Wind- und Sonnenkraft und trägt durch den Ausbau und Erhalt der Netzinfrastruktur zur Versorgungssicherheit bei.

Verantwortung
Verantwortlich handelt, wer nicht nur Eigeninteressen verfolgt, sondern auch die Konsequenzen seines Handelns auf andere und auf die Umwelt berücksichtigt.
VERBUND lebt den Gedanken der Nachhaltigkeit seit vielen Jahren. Umweltschutz, Ressourcenschonung und soziale Verantwortung sind die Hauptziele einer nachhaltigen Entwicklung von VERBUND. Wir respektieren die ökologischen Grenzen durch eine effiziente Nutzung der Ressourcen und streben gleichzeitig soziale Gerechtigkeit an.
Unsere Mitarbeiter:innen und Führungskräfte treffen Entscheidungen, die sowohl wirtschaftliche, ökologische als auch soziale Aspekte berücksichtigen. Wenn in diesen drei Bereichen unterschiedliche Auswirkungen auftreten, wägen wir sorgfältig die Vor- und Nachteile ab. Priorität haben solche Entscheidungen und Maßnahmen, die den besten langfristigen Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten.
Mehr Informationen zum Thema Verantwortung finden Sie in unseren nichtfinanziellen Berichten.
Seit 2019 unterstützt VERBUND den UN Global Compact – die weltweit größte Nachhaltigkeitsinitiative der Vereinten Nationen für Unternehmen. VERBUND bekennt sich zu den 17 Sustainable Goals (SDGs) und den zehn universellen Prinzipien aus den Bereichen Arbeit, Menschenrechte, Umwelt und Antikorruption.
Durch die drei strategischen Stoßrichtungen unserer Mission V fokussieren wir unser Engagement auf alle jene SDGs, die durch unsere Unternehmenstätigkeit wesentlich beeinflusst werden und mit denen wir einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten können.
Umwelt
VERBUND trägt aktiv zur Erreichung der europäischen und österreichischen Ziele in den Bereichen Klima und Energie bei. Außerdem verpflichten wir uns zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt.

Soziale Verantwortung
VERBUND steht für kooperative, faire und zuverlässige Zusammenarbeit. Daher ist uns ein konstruktiver Umgang mit Konflikten wichtig, um auch in Zukunft nachhaltige und sozialverträgliche Entscheidung zu treffen.

Corporate Governance
Corporate Governance dient als Oberbegriff für das gesamte System der Leitung und Kontrolle eines Unternehmens. Für VERBUND ist das System guter Corporate Governance von zentraler Bedeutung.

Corporate Responsibility Team
Bei Fragen wenden Sie sich bitte gerne per E-Mail an uns.